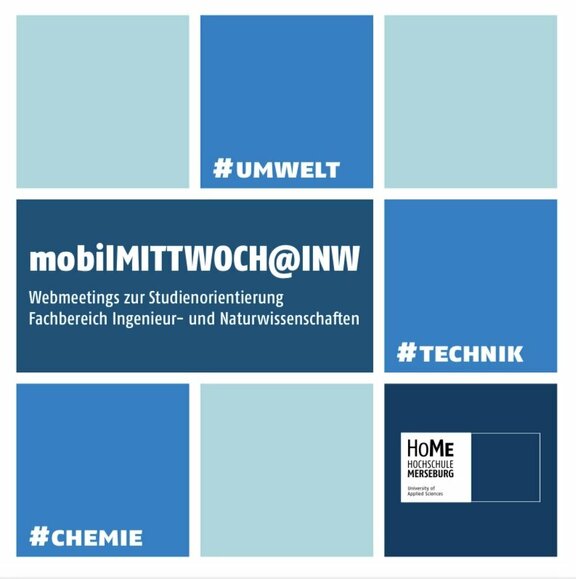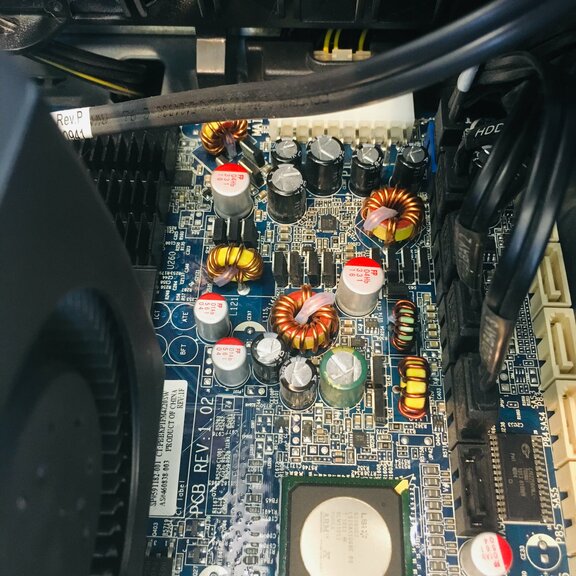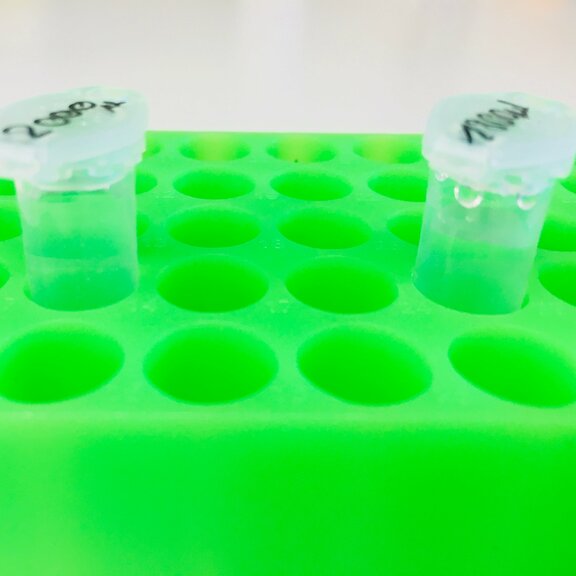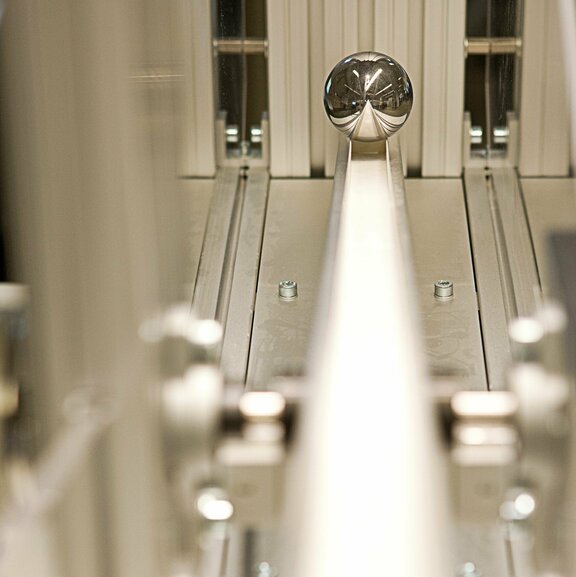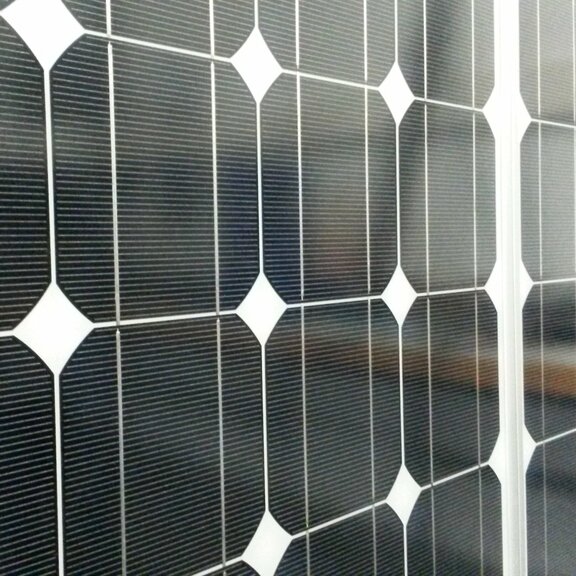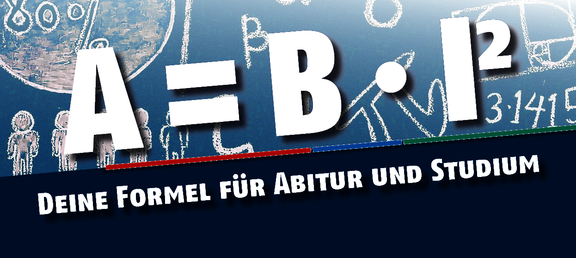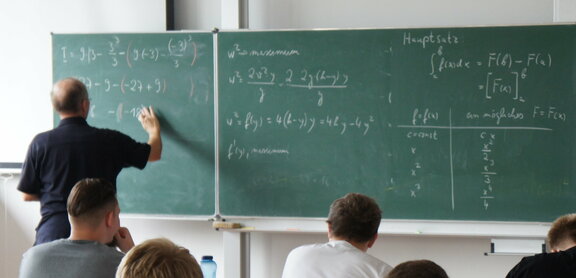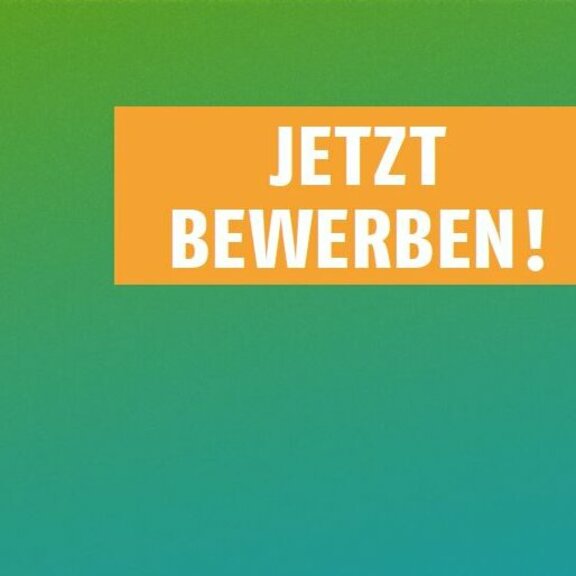| Abschluss | Studienform | Studiendauer | Studienbeginn | Zulassung | Sprache |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering | Dual | 9 oder 7 Semester | Wintersemester | frei | Deutsch |
Im Duo erfolgreich in die Wirtschaft!
Wollen Sie Theorie und Praxis im Doppelpack? Ihre Interessen liegen sowohl im technischen als auch wirtschaftlichen Bereich? Kein Problem! Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist eine Kombination aus dem Erlernen von Fachwissen an der Hochschule und dessen Umsetzung in die Praxis. Das Studium ist dual organisiert, d.h. Sie sind gleichermaßen Studierende an unserer Hochschule und Mitarbeiter in einem Unternehmen. Durch den permanenten Wechsel können Sie sowohl die in der Theorie erworbenen Kenntnisse in der Praxis anwenden, als auch aktuelle Problemstellungen aus der Praxis in der Theoriephase aufarbeiten. Zur Onlinebewerbung
News und Links
Studienmodelle
Ihre wissenschaftliche Ausbildung an der Hochschule wird durch längere Praxisphasen im Unternehmen ergänzt. So sammeln Sie bereits während des Studiums erste, praktische Berufserfahrung.
Vor Beginn des Studiums schließen Sie mit einem Unternehmen Ihrer Wahl einen Studienfördervertrag über die gesamte Laufzeit des Studiums ab.
Sie verbinden Ihr Hochschulstudium mit einer Berufsausbildung und erwerben neben dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zusätzlich einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf.
Vor Studienbeginn schließen Sie einen entsprechenden Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen Ihrer Wahl ab.
Studieninhalte

Betriebswirtschaftliche Lehrinhalte
Hier erlernen die Studierenden anhand von Übungsbeispielen die Buchung aller in einer Firma anfallenden Geschäftsvorfällen wie z. Bsp. den Einkauf von Material, den Verkauf von Produkten und die Zahlung von Löhnen und Gehältern. Zum Inhalt der Lehrveranstaltung gehören das Kennenlernen aller Jahresabschlussarbeiten in einer Firma sowie die Grundzüge der Bewertung von Vermögen und Schulden. Sie können anhand ausgewählter Kennzahlen eine erste grobe Jahresabschlussanalyse vornehmen und einen Betriebsabrechnungsbogen erstellen, innerbetriebliche Leistungen verrechnen, Produkte bzw. Aufträge sachgerecht kalkulieren.
Im Bereich der Investitionen werden die Studierenden in die Lage versetzt, die grundsätzlichen Ziele der Unternehmensführung über die Strukturierung und Systematisierung der Investitionsplanung umzusetzen. Gleichzeitig werden sie mit methodischen Ansätzen zur Investitionsentscheidung unter Risiko vertraut gemacht.
Ausgehend von den finanzwirtschaftlichen Zielen der Unternehmensführung erlernen die Studenten im Modul Finanzierung, die wesentlichen Finanzierungsarten hinsichtlich ihrer Anwendungsfelder und –voraussetzungen zu beurteilen und daraus Schlussfolgerungen für Finanzierungsentscheidungen abzuleiten. In den Übungen werden einfache Finanzierungsplanungen und Kapitalbedarfsrechnungen vorbereitet und durchgeführt.
Die Studierenden werden mit juristischen Problemstellungen und Rechtsnormen vertraut gemacht und in die Lage versetzt, weniger komplexe Fälle aus dem Wirtschaftsleben, insbesondere aus dem Kaufrecht, eigenständig zu lösen. In den Lehrveranstaltungen werden Grundlagenkenntnisse im Wirtschaftsprivatrecht, insbesondere im BGB (Allg. Teil, AT Schuldrecht und Kaufrecht) vermittelt.
Die Studierenden erfahren, welche Haftungsrisiken die Entwicklung und Herstellung von Produkten in sich bergen und welche Unterschiede zwischen Gewährleistungsrecht und Produkthaftungsrecht bestehen. Bei der Erarbeitung von technischen Dokumentationen können sie Probleme aus dem Urheberrecht und Markenrecht erkennen und Rechtsverletzungen vorbeugen.
Die Bewertung von Aktiva und Passiva vornehmen, Gewinn- und Verlustrechnungen aufstellen und die Zusammenhänge der steuerlichen Gewinnermittlung einerseits und der handelsrechtlichen Bilanzierung andererseits erkennen, sind Inhalte dieser Lehrveranstaltung. Die Studierenden erlernen, wie eine einfache Jahresabschlussanalyse durchzuführen ist.
Im Bereich Controlling werden die Entstehungsgeschichte, der Aufgabenbereich und Bedeutung der Controlling-Funktion erläutert und die Studierenden befähigt, ein angepasstes Planungs-, Kontroll- und Informationsversorgungssystem zu konzipieren.
Ausgewählte Lehrinhalte der Vertiefungsrichtungen
- Grundlagen, Begriffe, Standards, Topologien
- Netzwerkmodelle ISO/OSI und TCP/IP
- Standards und Protokolle in LAN und WAN
- TCP/IP Protokollfamilie
- Routing und Internet
- Wichtige Anwendungsprotokolle
- Netzwerkprogrammierung
- Standard Netzwerkdienste
- Einführung in Kryptische Protokolle
- Datenbankmodelle
- Konzeptueller und logischer Entwurf
- Implementierung und SQL
- Transaktionsverarbeitung
- Datenbanken und Software Engineering
- Anforderungen an das Softwareengineering
- Management von Softwareprojekten
- Vorgehensmodelle
- Anforderungsanalyse mit UML
- Entwurf mit UML
- Benutzerschnittstellen
- Dokumentation
- Validierung und Verifikation
- Grundlagen Qualitätsmanagement
- Einführung in das Technische Zeichnen
- Grundlagen des Normenwesens und der Normzahlen
- Allgemeine Ausführungsregeln für technische Zeichnungen
- Projektionsarten: orthogonal und axonometrisch
- Grundlagen der Darstellung und Bemaßung (Darstellung in Ansichten, Bruch- und Schnittdarstellungen, vereinfachte Darstellungen, Maßeintragungen)
- ausgewählte Formelemente und ihre Darstellung
- Technische Oberflächen
- Toleranzen und Passungen
- Gestaltung, Darstellung und Bemaßung einzelner Konstruktionselemente
- automatisierungsgerechte Gestaltung von Prozessen und Fertigungsabläufen unter Berücksichtigung der technisch-organisatorischen Verknüpfung von Informationsfluss, Materialfluss und Bearbeitungsvorgängen
- Flexible Automation, Kennzeichen von flexiblen Fertigungssystemen
- Vorstellung systemgeeigneter Werkzeugmaschinen
- Betrachtungen zu weiteren Systembausteinen
- Werkzeug und Werkstück: Verwaltung, Transport und Speicherung
- Maschineninterne und systeminterne Qualitätssicherung
- Steuerungshierarchie in den Systembausteinen und -ebenen
- Wirtschaftlichkeitsaspekte
- Exemplarische Betrachtungen der Vorgehensweise zur Systemgestaltung
Fabrikplanung:
- Begriffe, Einordnung, Planungsfelder
- Typisierung der Produktion
- Zielplanung
- Produktionsprogrammplanung
- Technologiewahl und –management
- Dimensionierung (Betriebsmittel, Personal, Fläche…)
- Strukturplanung (Grobplanung, Auswahl der Strukturform)
- Layoutplanung (Methoden der Maschinenaufstellungsplanung)
- Standortplanung
- Überblick zu rechnergestützten Werkzeugen der Fabrikplanung (digitale Fabrik)
Instandhaltung:
- Bedeutung, Einordnung in die Unternehmensprozesse
- Instandhaltungsstrategien
- Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit; Zuverlässigkeitskennzahlen
- Schwachstellenanalyse / Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse FMEA - Maschinen- und Anlagenüberwachung / -diagnose
- Überblick zur Tribologie / Schmierstoffsysteme, Betriebsstoffwechsel
- Instandhaltungsorganisation; Eigen- / Fremdinstandhaltung, Formen der Service-Bereiche
- Instandhaltungsplanungssysteme IPS - Instandhaltung und Arbeitsschutz
- Ersatzteilwirtschaft Planungsaufgabe
- Grundlegende Anforderungen
- Charakterisierung von Abfällen
- Sammlung und Transport von Abfällen
- Abfallaufbereitung und Wertstoffrecycling
- Biologische Abfallbehandlung
- Thermische Abfallbehandlung
- Deponietechnik
- Entsorgung gefährlicher Abfälle
- Einführung in die Problematik der Abwassertechnik
- Abwasseranfall und Beschaffenheit
- Gewässergüte und Gewässerschutz
- Abwassererfassung und Abwasserableitung
- Reinigung kommunaler und industrieller Abwässer
- Aufbau der Atmosphäre – physikalische und chemische Grundlagen (Temperaturgradienten, Schichtungsstabilität, Strahlungshaushalt)
- Natürliche und anthropogene Luftbestandteile – Quellen, Wirkungen von Luftschadstoffen
- Prozesse der Deposition
- Sekundäre Immissionen, photochemische Prozesse in der Troposphäre
- Aktuelle Situation der Luftbelastung, Schwerpunkt: Ozon-, Feinstaubbelastung, Klimagase
- Rechtliche Grundlagen der Luftreinhaltung
- Messung von Luftschadstoffen in Abgasen und der Umgebungsluft
- Bewertung von Messergebnissen – Immissionskenngrößen, Emissions- und Immissionsgrenzwerte
- Modellierung von Systemen
- Signalmodelle
- Elementare Übertragungsglieder
- Analytische Verfahren der Modellierung und Simulation
- Bilanzgleichungen und Verknüpfungsbeziehungen
- Mehrkörpersysteme
- Elektromagnetomechanische Wechselwirkungen
- Linearisierung nichtlinearer Systeme
- Diskrete Modelle
- Grundlagen Mikroprozessor-, Mikrorechner- und Mikrocontrollertechnologie
- Einsatzmöglichkeiten von Mikrocontrollern
- Hard- und Software der Evaluation Boards für Mikrocontroller
- Programmierung von Mikrocontrollern in Assembler und C++ im Vergleich
- Einführung, Historische Entwicklung von Industrierobotern (IR)
- Einsatzbereiche, Gründe für den Industrierobotereinsatz
- Aufbau und Struktur von IR
- Kinematik
- Antriebe
- Sensorik
- Greifsysteme
- Anwendungen
- Praktikumsversuche zu IR-Programmierung
- Struktur und Bindung organischer Moleküle
- Struktur und Reaktivität: Säure und Basen, polare und unpolare Moleküle
- Die Reaktionen der Alkane
- Cyclische Alkane
- Stereoisomere
- Eigenschaften und Reaktionen der Halogenalkane
- Weitere Reaktionen der Halogenalkane
- Die Hydroxygruppe: Alkohole
- Weitere Reaktionen der Alkohole und Die Chemie der Ether
- physikalisch-chemische Grundlagen für homogene Reaktionen
- Stoff- und Wärmebilanz idealer Reaktoren
- Verweilzeitverteilung in idealen und realen Reaktoren
- Reaktionsführung bei komplexen Reaktionen
- Beispiele für chemische Reaktoren
- Erweiterung der physikalischen-chemischen Grundlagen (Kinetik, Stofftransporteinflüsse)
- Mehrphasenreaktionen (Heterogene Katalyse, Feststoffreaktionen, Fluid/Fluidreaktionen, 3-Phasenreaktionen)
- Reaktormodellierung und Reaktorauslegung für Mehrphasenreaktoren
- Diagnose der limitierenden Teilschritte, Berechnung des kinetischen Regimes; Energieeintrag
- Optimierung der Selektivität durch geeignete Reaktionsführung, Stoffübergang in zwei Flüssigkeiten und Gas/Flüssig
- Grundlagen der Anlagentechnik
- Zeichnerische Darstellung von Anlagen (DIN EN ISO 10628, DIN 19227)
- Rohrleitungstechnik zur Förderung von Fluiden (inkl. Wanddickenberechnung)
- Fördertechnik zur Feststoffförderung
- Lagerung von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen
- Überblick der Mess-, Steuer-, Regelungs- und Prozessleittechnik
- Grundlagen der Anlagenplanung von der Idee bis zur Inbetriebnahme (Konzept, Basic-Engineering, Detail-Engineering, Inbetriebnahme)
- Sicherheitstechnische Grundlagen
- Sicherheitstechnische Kenndaten von Stoffen
- Sicherheitstechnische Analysen von Anlagen (Risikoanalyse)
- Einführung in Explosionsrichtlinien, Druckgeräterichtlinie
- Vorbeugende, konstruktive und allgemeine Sicherheitskonzepte
- Grundlagen elektrischer Maschinen
- Transformatoren
- Gleichstrommaschine
- Asynchronmaschine
- Synchronmaschine
- Grundlagen elektrischer Antriebe
- Praktika Elektrische Energietechnik
- Praktika Elektrische Maschinen und Antriebe
- thermodynamische Grundlagen der Klima- und Kältetechnik
- Grundprinzipien von Kompressions-, Absorptions- und Kaltgaskältemaschine
- Kältemittelproblematik
- Anpassung von Kälteprozessen an die Erfordernisse (Regeneration, Kaltdampfvorwärmung, Kaltdampfeinspritzung, überfluteter Verdampfer)
- Apparate und Anlagentechnik der Klima- und Kältetechnik
- Wandlung von regenerativer Energie zu Endenergie
- Strategien einer nachhaltigen Gesellschaft
- Nutzung der Solarstrahlung mittels Photovoltaik und Solarthermie
- Nutzung der Energie strömender Fluide (Wind- und Wasserkraft)
- energetische Nutzung von Biomasse
- Kombination von fluktuierenden und speicherbaren erneuerbaren Energien
Allgemeine Studienberatung

Elisa Karau-Unkroth
Für das duale Studium sind an unserer Hochschule die Hochschulzugangsberechtigung und ein Vertrag zwischen Studenten und Unternehmen erforderlich.
Für Sie ist wichtig, dass Sie mit dem Unternehmen klären, ob das duale Studium ohne oder mit Berufsausbildung realisiert werden soll und welche Vertiefungsrichtung Sie wählen möchten.
Zuerst bewerben Sie sich direkt bei einem Unternehmen. Die Bewerbung sollte schon rechtzeitig vor Studienbeginn erfolgen. Wenn Sie mit Unternehmen einen Vertrag über die gesamte Studienzeit abgeschlossen haben, können Sie sich an unserer Hochschule bis zum 30. September eines Jahres bewerben.
Wir kooperieren vor allem mit Firmen aus Mitteldeutschland.
Die Liste stellt nur eine Auswahl dar. Es gibt eine Reihe anderer Unternehmen, die mit uns im dualen Studiengang zusammenarbeiten. Wenn Sie ein weiteres Unternehmen finden, das Sie fördern möchte, sprechen wir gern die Details mit dem Unternehmen ab.
Im überbetrieblichen Ausbildungszentraum Holleben bei Halle kann man unterschiedliche Berufe erlernen. Für Abiturienten und Bewerber mit Fachhochschulreife wurde gemeinsam mit der Hochschule Merseburg ein Modell im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Energietechnik konzipiert, welches durch eine begleitende Berufsausbildung zum Industrie-Isolierer passgenau ergänzt wird. Durch dieses duale Studium können Nachwuchsfachkräfte unter anderem auf Projektleitungstätigkeiten in Isolierunternehmen vorbereitet werden.
Bei fristgerechter Bewerbung und erfolgter Zulassung bekommen Sie schriftlich von der Hochschule Bescheid, wann Sie sich zum Studium an der Hochschule Merseburg immatrikulieren können. Der Zulassungsbescheid wird in Ihrem Bewerber-Portal (HoMe-Portal) hinterlegt. Die Immatrikulation erfolgt digital in diesen Schritten:
[1] Versicherungsbescheinigung "M10" bei der Krankenkasse beantragen, falls noch nicht geschehen.
[2] Semesterbeitrag überweisen
[3] Einloggen ins Bewerbungs-Portal mit diesen Zugangsdaten:
- Benutzername: Ihre Bewerbungsnummer [123456]
- Passwort: Ihr Geburtsdatum [TT.MM.JJJJ]
[4] HochschulCard = Studierendenausweis beantragen, falls noch nicht geschehen
[5] Diese Unterlagen im Bewerbungs-Portal hochladen:
- Nachweis über die Einzahlung des Semesterbeitrages
- ggf. weitere Dokumente, wenn diese im Zulassungsbescheid aufgelistet sind
[6] Klicken: „Online-Immatrikulation durchführen“; nachdem Ihre Immatrikulation vom Studierendensekretariat bearbeitet wurde, dauert ca. 1-3 Tage, erhalten Sie eine E-Mail und können sich Ihre vorläufige Immatrikulationsbescheinigung im Bewerbungs-Portal herunterladen.
Gut zu Wissen
Der Studienabschluss Bachelor of Engineering im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen berechtigt zum Führen der Berufsbezeichnung INGENIEUR. Dieser Titel wird durch die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt verliehen.
Studienfachberatung

Prof. Dr. Dietmar Bendix
Koordination
Studienvorbereitung
Berufsperspektiven
Mit Ihrem Abschluss sind Sie in der Lage, an den Schnittstellen von Technik und Betriebswirtschaft zu arbeiten und die Kommunikation zwischen Technik- und Wirtschaftsspezialisten im Betrieb herzustellen. Vielleicht bietet sich auch Ihre gewählte Vertiefung für einen Berufseinstieg an? An dieser Stelle nur ein kurzer Einblick in das Spektrum Ihrer Einsatzgebiete:
- Vertrieb bzw. Verkauf technischer Produkte
- Service und Kundenbetreuung
- Kostenmanagement und Auftragskalkulation
- Qualitätsmanagement und Qualitätskontrolle
- Projektmanagement
- Planung und Fertigung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien
Ob Sie selbständig oder angestellt tätig werden, entscheiden Sie. Bestens präpariert sind Sie für beide Wege.
Sie können Ihr Studium aber auch direkt mit einem Masterstudiengang fortsetzen. Die Hochschule Merseburg bietet Ihnen entsprechend der technischen Vertiefung verschiedene Masterstudiengänge mit einer Studiendauer von drei Semestern an.